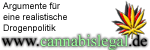|
Brief im Auftrag von Marion Caspers-Merk (August 2004)
Siehe auch:
- Schreiben von Marion Caspers-Merk (Mai 2004)
- Unsere Stellungnahme zum Schreiben vom Mai 2004
- Marion Caspers-Merk, Drogenbeauftragte
Sehr geehrter Herr ...,
haben Sie vielen Dank für Ihre Zuschrift vom 15.8.2004 zur Legalisierung von Cannabis. Frau Caspers-Merk hat mich gebeten, hierzu nehme ich wie folgt Stellung:
Die Legalisierung von Cannabis ist seitens der Bundesregierung nicht geplant. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach Artikel 4 Buchstabe c des Einheitsübereinkommens der Vereinten Nationen über Suchtstoffe von 1961 verpflichtet, die Verwendung von Suchtstoffen, einschließlich Cannabis, auf ausschließlich medizinische oder wissenschaftliche Zwecke zu beschränken. Daneben verlangt Artikel 3 Abs. 2 des VN-Suchtstoffübereinkommens von 1988 von allen Vertragsparteien, „vorbehaltlich ihrer Verfassungsgrundsätze und der Grundzüge ihrer Rechtsordnung (...) den Besitz, den Kauf oder den Anbau von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen für den persönlichen Verbrauch (…) als Straftat zu umschreiben“. Der Verkehr mit Cannabis zu anderen als medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken ist deshalb nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) verboten und strafbar.
Die Bundesregierung hält an der grundsätzlichen Strafbarkeit des Besitzes, des Anbaus und des Inverkehrbringens von Cannabis fest (§ 29 Abs. 1 BtMG), weil sie Cannabis nicht als harmlose Droge ansieht. Keine der neueren Studien hat Cannabis eine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ ausgestellt. Vielmehr wird auf eine Reihe akuter und langfristiger Beeinträchtigungen durch nichtmedizinischen Cannabiskonsum hingewiesen, die zwar normalerweise gering, bei chronischem Dauerkonsum aber mit größeren Risiken, bis zur psychischen Abhängigkeit, verbunden sind. Die Untersuchungen weisen auf die „vielen Unbekannten“ hin und empfehlen weitere wissenschaftliche Untersuchungen im Hinblick auf den Wirkmechanismus der Inhaltsstoffe von Cannabis.
Bei den ambulanten Drogenberatungsstellen nimmt der Anteil von Klienten, die wegen eines Cannabisproblems in die Behandlung kommen, zu. Im Jahr 2002 war Cannabiskonsum bei 30,5% der wegen Drogenproblemen ambulant Behandelten nach einem Bericht der Deutschen Referenzstelle für die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht der wichtigste Anlass der Betreuung. Im Übrigen wird Cannabis häufig zusammen mit anderen Suchtmitteln (wie z.B. Ecstasy und Alkohol) konsumiert.
Die Bundesregierung sieht deshalb derzeit keine Veranlassung, ein Freigabesignal für eine berauschende Substanz zu geben. Sie wird darin von der internationalen Gemeinschaft und der hierfür zuständigen Weltgesundheitsorganisation bestärkt, die an dem obligatorischen Cannabisverbot der Suchtstoffübereinkommen der Vereinten Nationen festhalten wollen. Deutschland ist zur Umsetzung der Übereinkommen vertraglich verpflichtet. Das Gleiche gilt übrigens in den Niederlanden, wo der Cannabiserwerb für den Eigenkonsum ebenfalls gesetzlich nicht erlaubt ist, sondern lediglich in sehr engen Grenzen geduldet wird. Bei den sog. Coffeeshops handelt es sich nicht um staatlich lizensierte Stellen, sondern um private Gaststättenbetriebe ohne Alkoholausschank, in denen bei Einhaltung bestimmter Auflagen sog. weiche Drogen (die Cannabisprodukte Haschisch und Marihuana) verkauft werden dürfen. Obwohl der Verkauf weicher Drogen auch in den Niederlanden strafbar ist, wird er nicht verfolgt, sofern es um geringe Mengen (5 Gramm pro Person) geht und weitere Auflagen erfüllt werden.
Gerade der liberale Ansatz der Niederlande stößt EU-weit und auch innerhalb der internationalen Gemeinschaft mehr und mehr auf Kritik. So hat der Rat der Europäischen Union am 27. November 2003 - nach langjährigem Widerstand der Niederlande - politisches Einvernehmen über einen Rahmenbeschluss zur Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im Bereich des illegalen Drogenhandels erzielt. Danach ist in den einschlägigen Gesetzen der Mitgliedstaaten u.a. für den Handel mit geringen Mengen von weniger gefährlichen („weichen“) Drogen eine Höchststrafe von mindestens 1 bis 3 Jahren vorzusehen. Dies könnte möglicherweise eine Verschärfung der Strafdrohung in den Niederlanden beim Besitz von Cannabis zur Folge haben.
Ich möchte ergänzend darauf hinweisen, dass die Initiative zur Revision des Schweizerischen Betäubungsmittelgesetzes, die seit 2001 beraten und diskutiert wurde und mit der der Anbau und der Konsum von Cannabis unter bestimmten Umständen legalisiert werden sollte, im Juni 2004 im Schweizerischen Parlament (Nationalrat) gescheitert ist.
In Deutschland kann unter bestimmten Voraussetzungen (u.a. Eigenverbrauch in geringer Menge) von der Bestrafung bzw. von der Strafverfolgung abgesehen werden (§§ 29 Abs. 5, 31a BtMG). Der Bundesregierung geht es bei der gesetzlichen Regelung des Umgangs mit Cannabis letztlich darum, einen verfassungskonformen Ausgleich zwischen dem erforderlichen Gesundheitsschutz für den Einzelnen und die Allgemeinheit einerseits, sowie den Einschränkungen der persönlichen Handlungsfreiheit infolge des strafbewehrten Cannabisverbots andererseits, zu finden. Dies hat das Bundesverfassungsverfassungsgericht in seiner bekannten „Haschisch-Entscheidung“ vom 9. März 1994 ausdrücklich anerkannt und u.a. aus diesem Grund die Rechtmäßigkeit der Cannabisverbote bestätigt. Mit seinem Beschluss vom 29.06.2004 (Az: BVerfG, 2 BvL 8/02) hat das Bundesverfassungsgericht seine früheren Beschlüsse zur Strafbarkeit und damit die Position der Bundesregierung ausdrücklich bekräftigt. Nach dem einstimmigen Kammerbeschluss liegen keine neuen Erkenntnisse vor, die die frühere Einschätzung zur Gefährlichkeit von Cannabis-Produkten erschüttern würde.
Als Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im Jahr 1994 regte die Bundesregierung seinerzeit bei den Landesjustizministerien die Festlegung von einheitlichen Kriterien für die Einstellungspraxis nach § 31a BtMG - insbesondere die Bestimmung der „geringen Menge“ für den Eigenkonsum von Cannabis im Sinne dieser Vorschrift - an. Es kam dann zwar nicht zu einer ländereinheitlichen Festlegung, da die Justizverwaltungen nach und nach in Einzelerlassen bzw. Richtlinien unterschiedliche Kriterien und Mengen für die Anwendung des § 31a BtMG festgelegt haben. Eine seinerzeit im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit im März 1997 vorgelegte rechtstatsächliche Untersuchung der Kriminologischen Zentralstelle zum Thema „Die Rechtsgleichheit und Rechtswirklichkeit bei der Strafverfolgung von Drogenkonsumenten“ (Nomos Verlag, Baden-Baden) ergab jedoch, dass beim Umgang mit sog. weichen Drogen, insbesondere Haschisch und Marihuana, hinsichtlich der Mengen, bei denen die Vorschrift des § 31a BtMG regelmäßig zur Anwendung kommt, bundesweit ein hohes Maß an Übereinstimmung in der strafrechtlichen Praxis vorliege, so dass von einer im Wesentlichen einheitlichen Rechtsprechung, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hatte, gesprochen werden könne.
Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung hat im Oktober 2002 beim Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, ein weiteres Forschungsprojekt zu dem Thema „Drogenkonsum und Strafverfolgungspraxis“ in Auftrag gegeben, dass im Oktober 2004 abgeschlossen sein wird. Ziel des Vorhabens ist die Aktualisierung der durch die Untersuchung der Kriminologischen Zentralstelle aus dem Jahre 1997 gewonnenen Erkenntnisse über die Einstellungspraxis nach § 31a BtMG und anderen Vorschriften in ausgewählten Bundesländern. Gleichzeitig sollen die Auswirkungen justizieller Sanktionen auf das Dogenkonsumverhalten untersucht werden.
Sollte sich aus diesen oder aus sonstigen Erkenntnissen ergeben, dass die erforderliche Bundeseinheitlichkeit nicht mehr gewährleistet ist, so wird die Bundesregierung mit den Ländern Kontakt aufnehmen und die notwendigen Maßnahmen prüfen.
Die Bundesregierung befürwortet alle Anstrengungen, um wirksame Arzneimittel auf der Basis von Cannabis in den Verkehr bringen zu können. Dies kann jedoch im Interesse der Patienten wie bei allen Arzneimitteln nur auf der Grundlage des Arzneimittelgesetzes (AMG) und des BtMG erfolgen. Danach müssen insbesondere reproduzierbare Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der eingesetzten Arzneimittel wissenschaftlich nachgewiesen werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können die entsprechenden Wirkstoffe in die Anlage III des BtMG (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel) aufgenommen werden. Dies ist bislang aufgrund klinischer Prüfungen für die Cannabis-Wirkstoffe Nabilon und Dronabinol erfolgt. Ebenso könnten natürliche Gemische (z. B. Cannabisextrakt) in die Anlage III aufgenommen werden, wenn dafür die Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Haschisch, Marihuana und anderen illegalen Hanfzubereitungen ist dies nicht der Fall. So sind bei diesen Produkten weder der Wirkstoffgehalt noch Art und Umfang schädlicher Beimengungen bekannt. Die Aufnahme dieser Zubereitungen in die Anlage III des BtMG ist deshalb nicht zu verantworten.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
--
Martin Langendorf
Wiss. Mitarbeiter
Abgeordnetenbüro Marion Caspers-Merk
Parlamentarische Staatssekretärin bei der
Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung
Drogenbeauftragte der Bundesregierung
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Hier geht es zu unserer Briefseite, hier zu Links und Dokumenten zur SPD.
Hier geht es zu unserer Linkseite zur Parteipolitik, mit Thesenpapieren der Parteien und unseren Erwiderungen darauf, Links zu parteipolitischen Onlineforen sowie zu den Listen der Abgeordneten der Fraktionen im Bundestag.