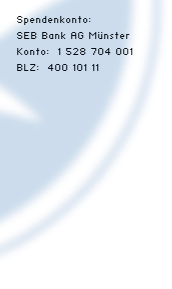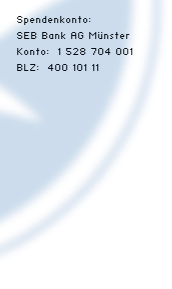|
|
Cannabispolitik in der Bundesrepublik Deutschland – Antworten der Drogenbeauftragten der Bundesregierung zu aktuellen Fragestellungen
Marion Caspers-Merk
Folgende drei Fragestellungen standen zur Beantwortung an:
1. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Cannabissituation in der Bundesrepublik Deutschland?
2. Welche drogenpolitischen Veränderungen sind aus Ihrer Sicht notwendig angesichts der Tatsache, dass Cannabisprodukte die am meisten konsumierten illegalen Drogen in Deutschland sind?
3. Wie stehen Sie zu den Forderungen aus der Fachwelt nach Entkriminalisierung (Opportunitätsprinzip wie in den Niederlanden) und/oder Teillegalisierung (wie in Belgien, Portugal und in der Schweiz geplant)?
Gestatten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung. Ihre Fragen gehen ein wenig einseitig davon aus, dass in der Fachwelt ohne Widerspruch eine weitere Entkriminalisierung des Umgangs mit Cannabis gefordert wird. Ich darf aber darauf hinweisen, dass auch in der Fachwelt - zumindest auf gesamteuropäische Ebene - noch sehr unterschiedliche Konzepte diskutiert werden. Und die reichen von sehr restriktiven Vorstellungen, etwa in Schweden, bis hin zu einer weitgehend liberalen Haltung, etwa in der Schweiz. Auch in der Schweiz, in der zur Zeit sehr weitgehende Überlegungen angestellt werden, Cannabisbesitz und -erwerb straflos zu stellen und auch den Anbau erlauben, gehen die Meinungen dazu auseinander. In einer kürzlichen Befragung der Schweizer Fachstelle für Alkoholfragen (SFA) haben über 60% der Befragten z.B. dafür plädiert, den öffentlichen Konsum von Cannabis weiterhin zu verbieten. Andererseits waren fast 70% der Auffassung, ein Verbot mache den Konsum nur verlockender. Mehr als zwei Drittel lehnten ein hartes Vorgehen der Polizei gegen Cannabiskonsumenten ab, aber rund die Hälfte vertrat die Meinung, dass eine Legalisierung den Konsum fördere und fast 60% meinten, Cannabiskonsum sei der erste Schritt zum Gebrauch harter Drogen. Sie sehen, dass die Diskussion durchaus kontrovers verläuft und dass die Auswirkungen der drogenpolitischen Maßnahmen, die ein Land unternimmt, genau überlegt werden müssen.
Zu 1.
Cannabis ist die am häufigsten sichergestellte illegale Droge in Deutschland und wird auch bei weitem am häufigsten im Rahmen von Konsumdelikten erfasst. Dies entspricht der Situation in vielen anderen Ländern. Dementsprechend ist der Anteil der Personen in Umfragen, die Erfahrungen mit Cannabis haben, die also im Laufe ihres Lebenszeitraums mindestens einmal konsumiert haben, relativ groß. Neben den Erhebungen des BKA stellen die Ergebnisse der Untersuchungen des Instituts für Therapieforschung (IFT) in München einen wichtigen Indikator für das Ausmaß der Drogenproblematik in Deutschland dar. Für das Jahr 2000 stieg die Life-time-Prävalenz - also der mindestens einmalige Konsum - in den alten Bundesländern von 14,2 % auf 21% an, in den neuen Ländern von 4,8 % auf 11%. Der Anteil der aktuellen Konsumenten stieg von 4,9 % der westdeutschen Befragten auf 6% und von 2,7 % der ostdeutschen Befragten auf 5%.
Hochgerechnet auf die Wohnbevölkerung sind das in Ostdeutschland 26.000 Personen und in Westdeutschland 214.000 Personen, die regelmäßig Cannabis konsumierten. Der Neugier- oder Probierkonsum verliert sich zwar bei den meisten Jugendlichen durch die Übernahme von Verantwortung, aber es bleibt eine hohe Zahl von Jugendlichen übrig, die täglich Cannabis konsumieren. Das sind 18 % derjenigen, die regelmäßig konsumieren. Dieses riskante Konsummuster nimmt gerade unter Jugendlichen zu.
Die Cannabisprodukte Marihuana und Haschisch sind seit über 25 Jahren die am meisten konsumierten illegalen Drogen in Deutschland. Etwa ebenso lange ist Cannabis Gegenstand vielfältiger Forschungsarbeiten. Dennoch war auch noch in den 90er Jahren der Wissensstand zu Wirkungen und Konsequenzen des Cannabiskonsums nicht eindeutig. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse muss die allgemeine Annahme, dass der Konsum von Cannabis eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit nach sich zieht, zurückgewiesen werden. Zwar ließ sich zeigen, dass stärker problembehaftete Personen besonders häufig konsumieren, Belege für eine schädigende Substanzwirkung von Cannabis ließen sich hingegen nicht finden. Der Konsum von Cannabis führt nicht zwangsläufig zu einer psychischen Abhängigkeit, es kann jedoch zu einer Abhängigkeitsentwicklung kommen. Eine solche Abhängigkeit vom "Typ Cannabis" (WHO-Kategorisierung: mäßig starke psychische Abhängigkeit) kann jedoch nicht primär aus den pharmakologischen Wirkungen der Droge erklärt werden, ohne vorab bestehende psychische Stimmungen und Probleme zu berücksichtigen. Die Abhängigkeit von Cannabis sollte als Symptom solcher Probleme gesehen werden. Ein immer wieder genanntes wichtiges Argument in der Diskussion um Cannabis ist die Annahme einer möglichen "Schrittmacherfunktion" für den Einstieg in illegale Drogen bzw. den Umstieg auf härtere Substanzen. Diese These muss laut Kleiber/Kovar nach Analyse der vorliegenden Studien zurückgewiesen werden. Der Konsum der Droge ist dennoch nicht frei von Risiken: In Bezug auf körperliche Risiken sind vor allem die Beeinträchtigung der Bronchialfunktionen und die kanzerogenen Effekte des Rauchens von Cannabisprodukten, vor allem in Kombination mit starkem Nikotinrauchen zu nennen. Hormonelle Beeinträchtigungen oder auch eine Beeinträchtigung der pränatalen Entwicklung sind nicht einheitlich belegt, dennoch sollte insbesondere in der Schwangerschaft auf einen Konsum von Cannabis (wie auch auf den Konsum anderer Drogen) verzichtet werden. Desgleichen ist bei jungen Jugendlichen entsprechende Vorsicht indiziert. Für den Bereich psychischer und sozialer Konsequenzen muss nach Kleiber/Kovar vor allem auf die zwar reversiblen, aber doch stundenanhaltenden kognitiven und psychomotorischen Beeinträchtigungen hingewiesen werden, die das Fahrvermögen und sicher auch die Leistungsfähigkeit in Schule und Beruf einschränken. Es sollte klar sein, dass ein hochfrequenter, stark dosierter Konsum mit der Bewältigung schulischer und beruflicher Anforderungen kaum zu vereinen ist. Auch angesichts der neueren Forschungsergebnisse darf nicht vernachlässigt werden, dass ein zwar geringer, aber doch feststellbarer Prozentsatz der dauerhaften Cannabiskonsumenten sich mit Folgeproblemen in Behandlung begibt. Mit fast 13.000 Personen, die sich mit einem schädlichen Gebrauch oder Abhängigkeit von Cannabisprodukten im Jahr 1997 an ambulante Einrichtungen wenden, hat sich dieser Personenkreis seit 1993 mehr als verdoppelt.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom 09.03.1994 festgestellt, dass die für Cannabis geltenden Verbote und Strafvorschriften des BtMG nicht verfassungswidrig sind. Das Gericht hat allerdings die Strafverfolgungsorgane aufgefordert, von der Verfolgung der in § 31 a des Betäubungsmittelgesetzes bezeichneten Straftaten unter den dort genannten Voraussetzungen nach dem Übermaßverbot grundsätzlich abzusehen bzw. die Strafverfahren einzustellen. In der Regel findet eine Verurteilung wegen des Besitzes kleiner Mengen Cannabis (bis 10 Gramm) nicht statt, wenngleich die Bundesländer für die "geringe Menge" Cannabis unterschiedliche Grenzmengen festgesetzt haben, die je nach Bundesland von 3 - 30 Gramm Cannabis reichen. 1998 wurden 216.682 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert. Davon waren 79.495 Fälle Konsumdelikte mit Cannabis und dessen Zubereitungen. Im Vergleich zu 1997 bedeutet dies einen Anstieg um 23,3%.
Ich habe auch Kenntnis von der zunehmenden Anzahl von Jugendlichen, die zu einer Medizinisch-Psychologischen-Untersuchung (MPU) aufgefordert werden, in der die Eignung zum Führen eines Fahrzeuges festgestellt wird. Dies geschieht auch in Fällen, wo ein Konsum nicht nachgewiesen werden konnte, lediglich der Besitz von Cannabis. Das Verkehrsministerium prüft z.Zt. in einer Untersuchung diese Entwicklung. Einige Gerichte halten diese Praxis auch für bedenklich. Solange keine eindeutigen Messverfahren bestehen, wird es allerdings zu keiner Veränderung kommen. Denn im Rahmen einer Gleichbehandlung mit Alkoholkonsum am Steuer müssten auch für Cannabis Grenzwerte festgelegt werden. Ein Fahren unter Cannabiseinfluss kann nicht toleriert werden.
Zu 2.
Mir sind die Entwicklungen in europäischen Nachbarländern, den Eigenkonsum von Cannabis weiter zu entkriminalisieren, bekannt. In den Niederlanden wird durch eine klare Unterscheidung zwischen Cannabis und Heroin/Kokain/LSD einerseits und zwischen Konsumenten und Händlern andererseits das Opportunitätsprinzip umgesetzt. Die Substanz wird gesetzlich und gesellschaftlich als tragbar eingestuft und nur der Handel damit verfolgt. Das holländische Betäubungsmittelgesetz unterscheidet zwischen "Hanferzeugnissen" und Substanzen, deren Konsum "inakzeptable Risiken beinhaltet". Der Handel mit Cannabis für den Eigenkonsum ist in den sog. Coffee-Shops toleriert, sofern fünf staatliche Bedingungen erfüllt werden: Keine Außenwerbung, kein Handel mit Heroin/Kokain/LSD, keine Belästigung der Umgebung, kein Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren, kein Verkauf von größeren Mengen als 5 Gramm. Die kommunale Coffee-Shop-Politik ist Sache der lokalen Behörden.
In Portugal und neuerdings auch in Belgien gibt es ebenfalls gesetzliche Initiativen zur Entkriminalisierung, nicht aber zur Legalisierung von Cannabis. Beides wird in der öffentlichen Debatte miteinander verwechselt.
In der Schweiz wird bereits seit längerem über eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes nachgedacht. Durchsetzungsfähig schien zunächst folgendes Modell: Aufhebung der Bestrafung von Besitz und Konsum. Der Handel mit Cannabis bleibt strafbar. Es wird aber das Opportunitätsprinzip für die Strafverfolgung des Handels eingeführt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Ich halte es aber für ein Problem, dass es in der Schweiz keine Angebote gibt für Jugendliche, die einen problematischen Cannabiskonsum haben. Denn dass der Konsum von Cannabis Probleme mit sich bringen kann, zeigt auch die schon erwähnte Studie des SFA. Jede bzw. jeder Fünfte der jüngeren Befragten mit Cannabiserfahrungen hat auch Probleme wahrgenommen. Und zwar interessanterweise weniger mit der Polizei, als vielmehr körperliche und psychische und auch die Befürchtung, psychisch abhängig zu werden vom Konsum. Ich mache mir außerdem Sorgen darüber, das bereits jetzt im Grenzbereich eine Sogwirkung eingetreten ist und sich Jugendliche aus Deutschland in der Schweiz in den Hanfläden mit Cannabis versorgen. Im Moment findet eine unkontrollierte Abgabe auch an Jugendliche statt. Die Schweiz ist zum Cannabisexportland geworden. Eine einheitliche und abgestimmte europäische Politik scheint nur schwer möglich zu sein, da beispielsweise Schweden ein völlig anderes Konzept hat.
Zu 3.
Schon auf Grund der völkerrechtlichen Vorgaben darf
der Verkehr mit Cannabis zu anderen als medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken nicht gesetzlich zugelassen werden. Deshalb wird es eine Legalisierung nicht geben. Ich hielte sie auch nicht für richtig, weil ich befürchte, dass dann der Konsum noch stärker zunimmt und damit auch die riskanten Konsummuster. Meines Erachtens brauchen wir eine Risikodebatte in unserer Gesellschaft über dem Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Denn wir können zwei Tendenzen in der Gesamtbevölkerung wahrnehmen:
Einerseits nimmt der Konsum psychoaktiver Substanzen, angefangen von Tabak und Alkohol bis zu Heroin langsam ab, aber gleichzeitig gibt es immer mehr Jugendliche, die im Rahmen einer "Spaßkultur" einen risikoreichen Konsum pflegen, ohne darüber kritisch nachzudenken. Besorgniserregend finde ich auch die Tatsache, dass die Drogenkonsumenten immer jünger werden. Nach Angaben von Wissenschaftlern trinken 5 % der 12jährigen regelmäßig Alkohol. Die Anzahl der Jugendlichen Raucher und hier vor allem der Mädchen nimmt zu. Das Einstiegsalter liegt bei 13 Jahren. Mit 15 erfolgt bei vielen der Einstieg in illegale Drogen.
Auf internationaler Ebene wird darüber diskutiert, dass es mehr Sinn macht von weichen und harten Konsummustern zu reden, als von weichen und harten Drogen. Die harten Konsummuster von Jugendlichen nehmen zu.
Cannabis-Probierkonsum wird bei Jugendlichen immer häufiger, fast jeder zweite in der Altersgruppe der 18 ist 20jährigen hat Erfahrungen; wenn auch die meisten Jugendlichen nur wenig konsumieren oder den Konsum später beenden, wächst auch die Zahl von Jugendlichen, die exzessiv konsumieren, zumeist noch zusammen mit anderen Mitteln, wie Alkohol und Ecstasy, und hier kommt es auch zu einer verstärkten Nachfrage nach Hilfe.
Das Bundesministerium für Gesundheit hat in Abstimmung mit einigen Bundesländern jetzt ein vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe koordiniertes Modellprojekt zur "Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten" begonnen. Dabei soll eine frühe Intervention helfen, durch möglichst gezielte Angebote zu Beginn eines problematischen Drogenkonsums Jugendlicher und junger Erwachsener beginnende Drogenkarrieren zu verhindern. Leitidee ist es, jungen erstauffälligen Drogenkonsumenten auf freiwilliger Basis ein gezieltes Informationsangebot zu unterbreiten.
Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion über die mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen verbundenen gesundheitlichen, psychischen und sozialen Risiken. Diese Risiken sind unabhängig davon, ob diese Substanzen legal oder illegal sind. Es sollte deshalb in dieser Debatte weder eine Verteufelung, noch eine Bagatellisierung von psychoaktiven Substanzen geben. Wir brauchen realistische und glaubwürdige Präventions- und Behandlungskonzepte, die von der Lebenswirklichkeit der Menschen ausgehen und ihnen helfen,
&Mac183; den Einstieg in den Konsum hinauszuzögern
&Mac183; den Ausstieg aus riskanten Konsummustern frühzeitig zu schaffen
&Mac183; den Ausstieg aus einer Abhängigkeit zu erreichen mit allen dafür zur Verfügung stehenden Hilfen, von der Abstinenztherapie bis zur medikamenten-gestützten Behandlung.
Ich bin mir allerdings auch darüber bewusst, dass eine reine Verbotspolitik das Problem nicht löst, sondern eher kontraktproduktiv sein kann und dass insbesondere Jugendliche einen liberaleren Umgang mit Cannabiskonsum wünschen. Politik muss aber ausgewogen bleiben: ich kann nicht beim Umgang mit Tabak und Alkohol auf die Bremse treten und bei Cannabis gleichzeitig auf's Gas. Eine Kriminalisierung von Jugendlichen ist aber sicherlich nicht der geeignete Weg, um eine kritischen Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu erreichen. Der Umgang in unserer Gesellschaft mit psychotropen Substanzen, einschließlich Alkohol und Tabak, ist nach wie vor von Widersprüchlichkeiten geprägt. In der Drogen- und Suchtpolitik gibt es keinen Königsweg, sondern ein Mosaik von - bestmöglich - aufeinander abgestimmten Bausteinen von Prävention, sozialer und therapeutischer Unterstützung und Hilfe - einschließlich Schadensminderung und Überlebenshilfe.
Korrespondenzadresse:
Marion Caspers-Merk, MdB
Drogenbeauftragte der Bundesregierung
im Bundesministerium für Gesundheit
Mohrenstr. 62
10117 Berlin
Email: poststelle@bmg.bund.de
|